Warum das Recht auf Stadt auch Recht auf Gesundheit bedeutet
Wie hängen Initiativen, die sich für ein Recht auf Stadt einsetzen mit der Frage nach einem gesunden Leben zusammen? Mediziner*innen, Forschende und Initiativen werden laut für das Recht auf Stadt.

Takeaways
Das erwartet Sie in dieser Ausgabe
- Interview: Lisa Kamphaus und Richard Bůžek erklären, wie die Kritische Sozialepidemiologie Recht auf Stadt und Gesundheit verbindet.
- Tool: Der StadtRaumMonitor soll es Städten und Gemeinden ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Bewohner*innen schnell und einfach zu erheben.
- Studiensteckbrief: In Hartford (Connecticut) erklären Jugendliche in einer Befragung, was für sie eine lebenswerte Stadt ausmacht.
- Praxistauglich: Das Gesundheitskollektiv Berlin bestärkt Menschen in Neukölln in der Forderung nach Recht auf Stadt und auf Gesundheit – bald sogar in einem eigenen Gesundheitszentrum.
Vielleicht müssen wir ja gar nicht den Strand unterm Kopfsteinpflaster suchen, wenn die Stadt selbst ein lebenswerter Ort ist.
Recht auf Stadt ist Recht auf Gesundheit
Fühlen Sie sich wohl dort, wo sie leben? An einem Ort zu wohnen, der es fördert gesund zu leben, ist ein Privileg. Gerade in Städten, in denen die Mietpreise immer weiter steigen, kann es schwer sein, eine passende Wohnung in einem Viertel fernab schädlicher Umwelteinflüsse zu finden. Hinter Recht auf Stadt steckt also mehr als die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum. Wir haben recherchiert, wie Mediziner*innen, Forschende und Initiativen das Recht auf Stadt als Recht auf Gesundheit einfordern.
Wir freuen uns, Sie zur fünften Ausgabe von Upstream zu begrüßen! Wenn Sie uns zum ersten Mal lesen: Hier schreiben Sören Engels, Anne Wagner und Maren Wilczek, Journalismus- und Medizinstudierende der Universität Halle.
Upstream gefällt Ihnen? Leiten Sie diese Mail doch an Freund*innen und Kolleg*innen weiter oder teilen Sie uns auf Twitter! Sie haben diese Mail per Weiterleitung erhalten? Hier können Sie uns direkt abonnieren!
Interview

Recht auf Gesundheit heißt auch Recht auf Stadt
“Recht auf Stadt” – hinter diesen Worten steckt mehr als die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum. Lisa Kamphaus und Richard Bůžek von der AG Kritische Stadtgeographie an der Universität Münster erklären im Interview, dass Recht auf Stadt vielmehr bedeutet, allen Menschen freie Entfaltung und ein sozial gerechtes Leben in Städten zu ermöglichen. Wir haben sie außerdem gefragt, was das Thema mit Gesundheit verbindet und was Mediziner*innen vom Ansatz der Kritischen Sozialepidemiologie lernen können.
Was hat Recht auf Stadt mit Gesundheit zu tun?
Richard Bůžek: Dass Zusammenhänge zwischen menschengemachten Lebensbedingungen und der Gesundheit bestehen, ist nichts Neues. Aber wir können uns ja nicht damit zufrieden geben, die sozialen Determinanten zu kennen, die uns krank machen. Wir müssen die Strukturen dahinter bearbeiten und das sind eben gesellschaftliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Hier setzt die Kritische Sozialepidemiologie sowohl aktivistisch als auch wissenschaftlich an, die individuell erfahrenen krankmachenden Verhältnisse kollektiv zu verändern, indem städtische Ressourcen und Räume von Wohnen, Arbeit oder Fürsorge sozial-gerecht für alle organisiert werden.
Wie werden Recht auf Stadt und Gesundheit praktisch verknüpft?
Lisa Kamphaus: Ein Beispiel, wie Menschen unterstützt und das Recht auf Stadt und Gesundheit umgesetzt werden können, sind Medinetze. Da wenden sich Menschen hin, die aus dem medizinischen Versorgungssystem ausgeschlossen sind, zum Beispiel weil sie papierlos oder nicht krankenversichert sind. Durch diesen Ausschluss haben sie nicht die gleichen Chancen zur vollständigen Entfaltung ihres Gesundheitspotentials. Einige Medinetze haben sich politisch dafür eingesetzt, dass es einen anonymen Krankenschein gibt, durch den alle Menschen sich medizinisch versorgen lassen können.
Was steckt hinter der Kritischen Sozialepidemiologie?
Lisa Kamphaus: Die Kritische Sozialepidemiologie ist ein Forschungsansatz, der ursprünglich aus Lateinamerika kommt. Er betrachtet die gesellschaftlichen und strukturellen Entstehungsbedingungen von Krankheit und möchte sie verändern. Gesundheit lässt sich nicht allein auf biologische Ursachen zurückführen, sondern vielmehr sind es soziale, gesellschaftliche Gegebenheiten und Gewordenheiten, die krank machen. Hier setzt die Kritische Sozialepidemiologie an, indem sie sich ethnografisch, qualitativ und vor allem nah an den Menschen mit Gesundheit auseinandersetzt. Sie erforscht auch die komplexen Verschränkungen von ethnischer, rassistischer und sexistischer Diskriminierung und versucht, Gesundheit intersektional zu adressieren, zu kritisieren und zu ändern. Außerdem kritisiert sie die kapitalistischen Strukturen des Gesundheitswesens. Im Globalen Norden ist dieser Forschungsansatz bisher allerdings noch kaum bis gar nicht präsent.
Was kann die Kritische Sozialepidemiologie leisten, das die Medizin allein nicht kann?
Lisa Kamphaus: Sie ist eine Betrachtungsweise von Gesundheit, die nicht nur, wie es auch die Public Health Forschung macht, an den sozialen Determinanten von Gesundheit ansetzt. Sie setzt sich außerdem mit den Prozessen und gesellschaftlichen Verhältnissen, die die sozialen Determinanten bedingen und hervorbringen, auseinander.
Richard Bůžek: Michael Marmot hat es auf den Punkt gebracht mit der Frage: Warum die Menschen nur behandeln und sie dann wieder in die Verhältnisse zurückschicken, die sie krank machen? Genau das ist der Anspruch der Kritischen Sozialepidemiologie: Es nicht bei Symptombehandlung zu belassen, sondern die krank machenden Verhältnisse adressieren und kollektiv zu verändern.
→ Recht auf Stadt und Recht auf Gesundheit – warum sollten diese Ansätze zusammen gedacht werden? Wie können Medizin und Kritische Sozialepidemiologie einander ergänzen? Und was muss sich ändern, damit interdisziplinäres Arbeiten tatsächlich gelingt? All diese Fragen haben Lisa Kamphaus und Richard Bůžek uns beantwortet. Lesen Sie mehr in der Langfassung des Interviews.
Tool
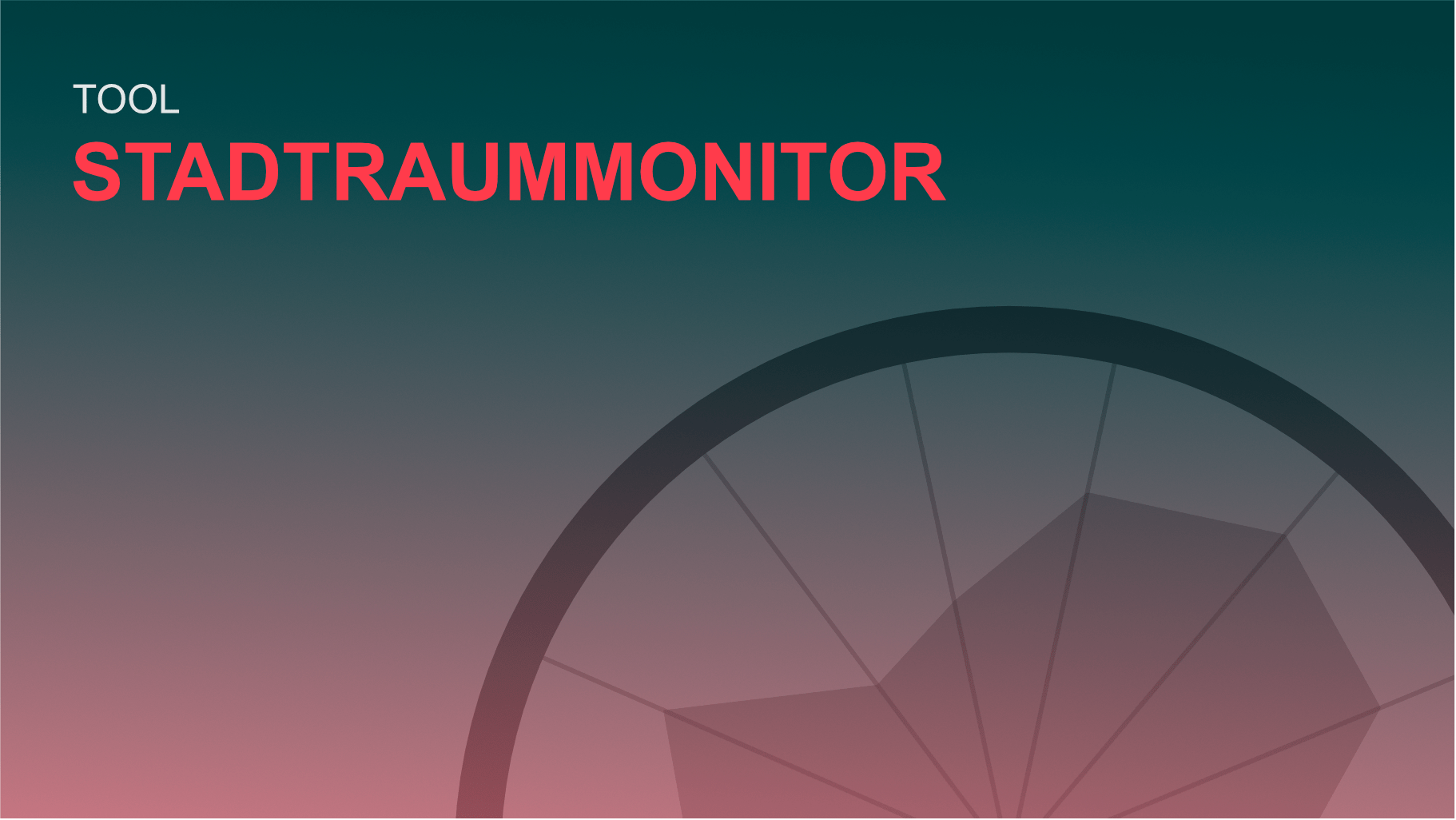
Lebensqualität auf dem Radar: Der StadtRaumMonitor
Wie gut lebt es sich in einer Stadt, einer Gemeinde oder einem Kiez? Diese Frage soll der StadtRaumMonitor im wahrsten Sinne des Wortes auf den Schirm bringen. Das planen jedenfalls die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen und das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg.
Vierzehn Punkte rund ums Stadtleben
Der StadtRaumMonitor ist ein Werkzeug, um das Erleben und die Bedarfe von Bürger*innen zu erheben. Mit 14 Fragen werden Faktoren, die Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden haben, abgefragt. Die Befragten bewerten beispielsweise die Versorgungslage und die Freizeitmöglichkeiten auf einer Skala von eins (sehr schlecht) bis acht (sehr gut) und können mit eigenen Worten ergänzen, was sie als besonders gut und was als verbesserungswürdig empfinden. Die Erhebung kann individuell, in Gruppen, auf Papier oder online stattfinden. Als Ergebnis liefert der StadtRaumMonitor ein Radardiagramm, das Stärken und Schwächen eines Ortes sichtbar macht, und qualitative Antworten, die die Erhebung um Erklärungen und Details ergänzen.
Vorbild für den StadtRaumMonitor ist das Place Standard Tool. Es ist seit 2015 in Schottland im Einsatz, mit dem Ziel, gesundheitlicher Ungleichheit mit einem Ansatz zu begegnen, der die Bevölkerung mit einbezieht. Seit Sommer 2020 wird der StadtRaumMonitor in einigen deutschen Städten und Gemeinden erprobt. Ab Ende 2021 soll er bundesweit verfügbar sein. Sie können ihn bereits jetzt online austesten.
Was denken Sie?
Während der Recherche für diese Ausgabe hat uns ein Leser den StadtRaumMonitor empfohlen. Selbstverständlich haben wir ausprobiert, wie wir selbst die Lebensqualität in unseren Nachbarschaften einschätzen. In den veranschlagten 10-15 Minuten sind wir damit nicht fertig geworden – dafür regen die Fragen zu sehr zum Nachdenken und Diskutieren an.
Der National Health Service Scotland hat das Place Standard Tool 2017 evaluiert. Die Befragung kann ein guter Ausgangspunkt für partizipative Gestaltungsprozesse sein, so die Erfahrung mehrerer Gemeinden. Dafür sei es allerdings wichtig, einen repräsentativen Teil der Bevölkerung zu befragen und die Kapazitäten zu haben, um all die Antworten auch wirklich auszuwerten.
→ Haben Sie sich den StadtRaumMonitor schon angesehen? Was halten Sie von diesem Ansatz, Menschen in die Gestaltung ihrer Nachbarschaft einzubinden? Schreiben Sie uns gerne Ihre Einschätzung per E-Mail oder diskutieren Sie auf Twitter mit uns.
Studiensteckbrief
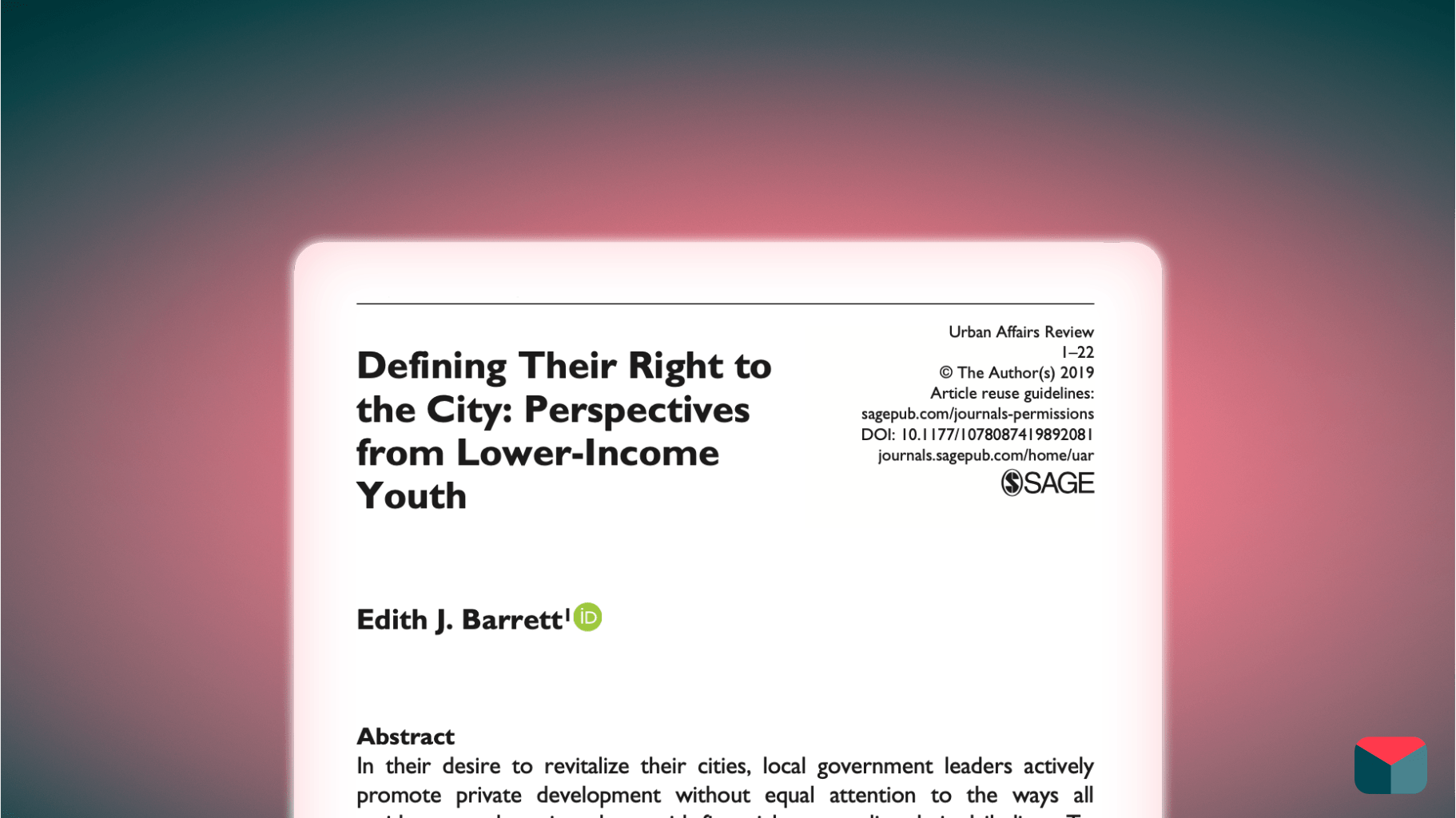
Jugendliche als Stadtplaner*innen
Publikation:
Urban Affairs Review
Autorin:
Edith J. Barrett (University of Connecticut, Hartford)
Gegenstand:
Wie würden Jugendliche eine Stadt gestalten, die ihnen ermöglicht, sich frei zu entfalten und gesund zu entwickeln?
Methode:
Befragung von 27 Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren in 30- bis 45-minütigen Interviews
Zeitraum:
Die Erhebungen fanden 2014 und 2018 statt. Die Untersuchung wurde 2021 veröffentlicht.
Hintergrund:
Emotionale, psychologische und soziale Faktoren beeinflussen nicht nur das aktuelle Wohlbefinden von Jugendlichen, sondern wirken auch auf ihre zukünftige Gesundheit. Im Jugendalter entwickeln sich Menschen von Kindern zu Erwachsenen und werden unabhängig. In diesem Prozess ist es wichtig, (nicht nur) physischen Raum zu haben, um Autonomie und eine soziale Gemeinschaft zu entwickeln.
Ergebnis:
Die Forderungen der Teenager*innen teilt Barrett in drei Bereiche ein:
- Recht auf physischen Raum: Gut erreichbare, saubere, gepflegte und ruhige Orte mit guter Luft, an denen die Jugendlichen sich sicher fühlen und die der gesamten Nachbarschaft Möglichkeiten für Aktivitäten bieten
- Recht auf psychologischen Raum: Ein Umfeld, in dem sie weder Vorurteilen noch (vor allem rassistischer) Diskriminierung ausgesetzt sind und das ihnen die Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben bietet
- Recht auf politischen Raum: Mitspracherecht haben, gehört werden und in der Schule nicht nur die Bildung für gesellschaftliche Teilhabe erhalten, sondern Ruhe, Bestärkung und Möglichkeit für freie Entfaltung finden
Gut zu wissen:
Der Bundesstaat Connecticut hatte zum Zeitpunkt der Befragung die zweithöchste Einkommensungleichheit innerhalb der USA. Barretts Team hat nur Jugendliche aus einkommensschwachen Familien befragt, darunter 26 Schwarze und People of Color. Eine wesentliche Forderung der Jugendlichen in allen drei Bereichen ist Chancengleichheit gegenüber Gleichaltrigen, die weiß sind und in wohlhabenden Nachbarschaften leben.
Praxistauglich

Ein Gesundheitszentrum für den Kiez
“Recht auf Stadt – Recht auf Gesundheit” – unter diesem Motto hat das Gesundheitskollektiv Berlin im Frühjahr 2016 den Auftakt seines Gesundheitszentrums gefeiert. Fünf Jahre später ist es soweit: Im Norden Neuköllns eröffnet der Verein ein Stadtteilgesundheitszentrum. Arztpraxen, Sozialberatung, psychologische Beratung und ein Café für Begegnungen, Initiativen und Selbsthilfegruppen finden dort ihren Platz. Doch bis dorthin war es ein langer Weg, der auch heute nicht ganz ohne Probleme verläuft.
Was braucht der Kiez?
Zunächst musste das Gesundheitskollektiv herausfinden, wo genau in Berlin ein Gesundheitszentrum am sinnvollsten ist. “Wir haben anhand von Sozial- und Morbiditätsdaten geschaut, wo es Bedarf nach besserer Versorgung gibt”, erklärt Patricia Hänel. Sie ist Ärztin und seit über sechs Jahren Mitglied des Gesundheitskollektivs. Schließlich habe das Kollektiv zwischen Wedding und Neukölln entscheiden müssen – und Neukölln gewählt, als ihm dort eine Immobilie angeboten wurde. Vor Ort hat das Kollektiv mit Fokusgruppenbefragungen und einem Fragebogen für Bürger*innen weitergeforscht.
Für ein Ehrenamt braucht man Ressourcen und Privilegien.
Partizipation ist jahrelange Arbeit
Das Gesundheitskollektiv versuche, Bürger*innen mit in seine Arbeit einzubeziehen. Das sei jedoch nicht einfach, so Patricia Hänel im Interview: “Es reicht nicht, zu sagen ‘Kommt alle’. Man muss die Leute aktiv reinholen, Meinungen einholen und zum Mitmachen motivieren. Aber für ein Ehrenamt braucht man Ressourcen und Privilegien.”
Eine weitere Herausforderung sei, den Eindruck zu verhindern, die Beteiligung sei wirkungslos. “Wer sich noch nie mit den Strukturen des Gesundheitswesens beschäftigt hat, kann nur schwer verstehen, was die eigentlichen Defizite sind und was man dagegen tun könnte”, sagt Hänel, “Im Gesundheitszentrum haben wir Wissen, Erfahrung und eine bestimmte Vorstellung davon, was wahrscheinlich gut wäre. Aber es ist ja ein bisschen überheblich zu sagen ‘Ich weiß besser als ihr, was die Lösung für euer Problem ist.’”Das zu verhandeln sei ein langwieriger Prozess, erklärt sie: “Da gibt es keine schnellen Erfolge, das ist jahrelange Arbeit.”
Gesundheitsversorgung unter einem Dach
Das Gesundheitskollektiv hat seine Angebote bislang dezentral organisiert. Ab Herbst 2021 werden sie gemeinsam im Stadtteilgesundheitszentrum zu finden sein. Von einem zentralen Café und Begegnungsort aus können Besucher*innen Ärzt*innen, psychologische und soziale Beratung erreichen.
Aufgrund des Kooperationsverbots werden die Räume und Praxen jedoch nicht die offene Einheit sein, die das Kollektiv sich eigentlich vorstellt, erklärt Patricia Hänel: “Wir müssen sicherstellen, dass Arztpraxen und die Beratung, die vom Verein angeboten wird, unabhängig voneinander funktionieren und finanziert sind und dass der Datenschutz eingehalten wird. Die beiden Arztpraxen brauchen jeweils völlig abgeschlossene Räumlichkeiten. Wir hätten eigentlich gerne eine Physiotherapie- Praxis dabei. Aber auch die hätte eine völlige räumliche und wirtschaftliche Trennung gebraucht, die wir gar nicht abbilden können.” Es sei eine groteske Situation, eine künstliche Trennung zu schaffen, obwohl eigentlich gerade bei mehrfach erkrankten Patient*innen eine gemeinsame Behandlung durch verschiedene Versorger wünschenswert ist.
Ein weiteres Problem sei die Finanzierung des Projekts. Das Gesundheitskollektiv erhalte Fördergelder und Spenden, sagt Patricia Hänel, doch das sei keine ausreichende Finanzierung, mit der langfristige Planung möglich ist. Das Gesundheitskollektiv setze sich politisch für eine gemeinwohlorientierte Gesundheitsversorgung ein.
→ Wie gelingt es dem Gesundheitskollektiv Berlin, Angebote zu verwirklichen und Bürger*innen aktiv einzubringen? Darüber haben wir mit Patricia Hänel gesprochen. Lesen Sie hier das gesamte Interview!
Aktuelles
Das sollten Sie noch wissen
- “Stell dir vor, du bist krank – und deine Behandlung verläuft bestmöglich.” Unser Kommilitone Oliver Haupt hat im Podcast Unbehandelt Antworten auf die Frage gesucht, wie das ideale Gesundheitssystem aussieht. Gibt es das überhaupt?
- In der Nacht vom 8. auf den 9. September jährt sich der Brand des Geflüchtetenlagers Moria. Bevor das Feuer ausbrach, waren Michael Trammer und Raphael Knipping auf Lesbos und haben das Leben von Menschen, die dorthin geflohen sind, dokumentiert.
- Gesundheitsentscheidungen sollten auf aktuellem und evidenzbasierten Wissen beruhen. In vielen Hausarztpraxen fehlt jedoch das nötige Informationsmaterial. Andrea Siebenhofer-Kroitzsch ist Leiterin des Projekts EVI-Box, das das ändern soll. Silke Jäger hat für Riffreporter mit ihr gesprochen.
Ausblick
Sind Sie schon einmal durch eine große Stadt gelaufen und haben an jeder Ecke etwas Neues entdeckt, das sie gerne genauer ansehen wollten? So geht es uns mit der Recherche für diesen Newsletter. Darum haben wir beschlossen, dass uns der urbane Raum in der folgenden Ausgabe noch einmal beschäftigen wird: Wir nehmen uns die Neurourbanistik vor.
In diesem Feld gehen Neurowissenschaften, Psychologie, Architektur und Stadtforschung gemeinsam der Frage nach, wie lebenswerte und gesundheitsförderliche Städte gestaltet sind. Von dort aus werden wir uns langsam aber sicher dem Thema nähern, von dem viele von Ihnen uns geschrieben haben, dass es Sie besonders interessiert: mentale Gesundheit. Wir sind gespannt, was wir herausfinden werden und hoffen, Sie begleiten uns weiterhin.
Wissen ist Diskurs
Sommerloch? Von wegen! Für keine Ausgabe haben wir so viel mit Leser*innen kommuniziert wie für diese. Wir bedanken uns herzlich für das Interesse, Vertrauen und die Unterstützung. Upstream lebt auch von Ihrem Feedback, Ihren Hinweisen und dem gegenseitigen Austausch. Sie haben Fragen zu unserem Newsletter? Möchten uns Tipps oder Anregungen geben? Oder einfach nur ins Gespräch kommen? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder antworten Sie einfach auf diese.
Übrigens: Auf Twitter folgen uns über 200 Accounts! So richtig ins Diskutieren gekommen sind wir dort aber noch nicht. Vielleicht möchten Sie das ja ändern? Treten Sie mit uns in Kontakt, verlinken Sie uns und teilen Sie Ihre Gedanken unter unseren Tweets. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen!
Anhang
Transparenz
Rund um medizinische Themen sind Transparenz und Vertrauen wichtig. Darum stellen wir am Ende jeder Ausgabe unsere Quellen vollständig dar. Auf der Website ist unser journalistisches Selbstverständnis festgehalten.
Quellen
- Barrett E. J. (2021): Defining Their Right to the City: Perspectives from Lower-Income Youth. Urban Affairs Review. 2021;57(3):709-730
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA, 2020): "StadtRaumMonitor – Wie lebenswert finde ich meine Umgebung?". Köln. (zuletzt abgerufen am: 03.08.2021)
- NHS Health Scotland (2017): Place Standard process evaluation: learning from case studies in year one. Edinburgh. (zuletzt abgerufen am: 03.08.2021)
- Plantz, C., Mekel, O., Sammet, T., Köckler, H., Mensing, M., Fauth, E., Reichert, T., Karnebogen, F. (2020): Der StadtRaumMonitor – ein Instrument für mehr Beteiligung und Intersektoralität in der gesundheitsfördernden Stadtentwicklung, auch und gerade in Corona-Zeiten. Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. (Hrsg.) für Kongress Armut und Gesundheit 2021. (zuletzt abgerufen am: 03.08.2021)