Suizide sind vermeidbare Todesfälle
Im Jahr 2020 starben in Deutschland 9.206 Menschen durch Suizid. Wie lassen sich die Zahlen verringern? Außerdem sprechen wir mit Olivier David darüber, wie Armut und psychische Krankheit zusammenhängen.

Takeaways
Das erwartet Dich in dieser Ausgabe
- Schlaglichter: Diese Maßnahmen verhindern Suizide.
- Narrative hinterfragt: Wir dürfen nicht aus falscher Vorsicht schweigen.
- Interview: Armut macht psychisch krank. Warum man es sich leisten können muss, Innenschau zu betreiben, berichtet Olivier David im Interview.
Achtung: In dieser Ausgabe geht es um Suizide, Suizidalität und psychische Krisen. Wenn dir diese Themen nicht gut tun, lies den Newsletter lieber nicht oder nicht alleine. Dir geht es aktuell nicht gut? Hier findest Du Hilfe:
Wir sind zurück
Suizide sind vermeidbare Todesfälle
Seit den 80er Jahren hat sich die Zahl der Todesfälle durch Suizid fast halbiert. Doch noch immer sterben zu viele Menschen durch Suizid. Allein im Jahr 2020 waren es in Deutschland 9.206 Menschen. Wir fragen uns: Was verhindert diese Todesfälle?
Medien tun sich schwer, über das Thema zu berichten. Der Presserat rät Journalist*innen zu Zurückhaltung. Wir besprechen, warum wir als Gesellschaft trotzdem über Suizide reden sollten und wie.
Außerdem reden wir mit Olivier David. Er hat im Februar eine Autobiografie veröffentlicht: “Keine Aufstiegsgeschichte. Warum Armut psychisch krank macht”. Darüber wollten wir mehr wissen. Im Interview beantwortet David Fragen rund um Armut, psychische Erkrankung, seine persönliche Geschichte und seinen Blick auf die Gesellschaft.
Da sind wir also wieder. Hatten wir zuletzt nicht große Neuerungen versprochen? Was euch in Zukunft erwartet, lest ihr im Ausblick. Wir freuen uns auf ein neues Jahr mit euch!
Aus Leipzig und Halle grüßen euch herzlich
Maren und Sören
Schlaglichter
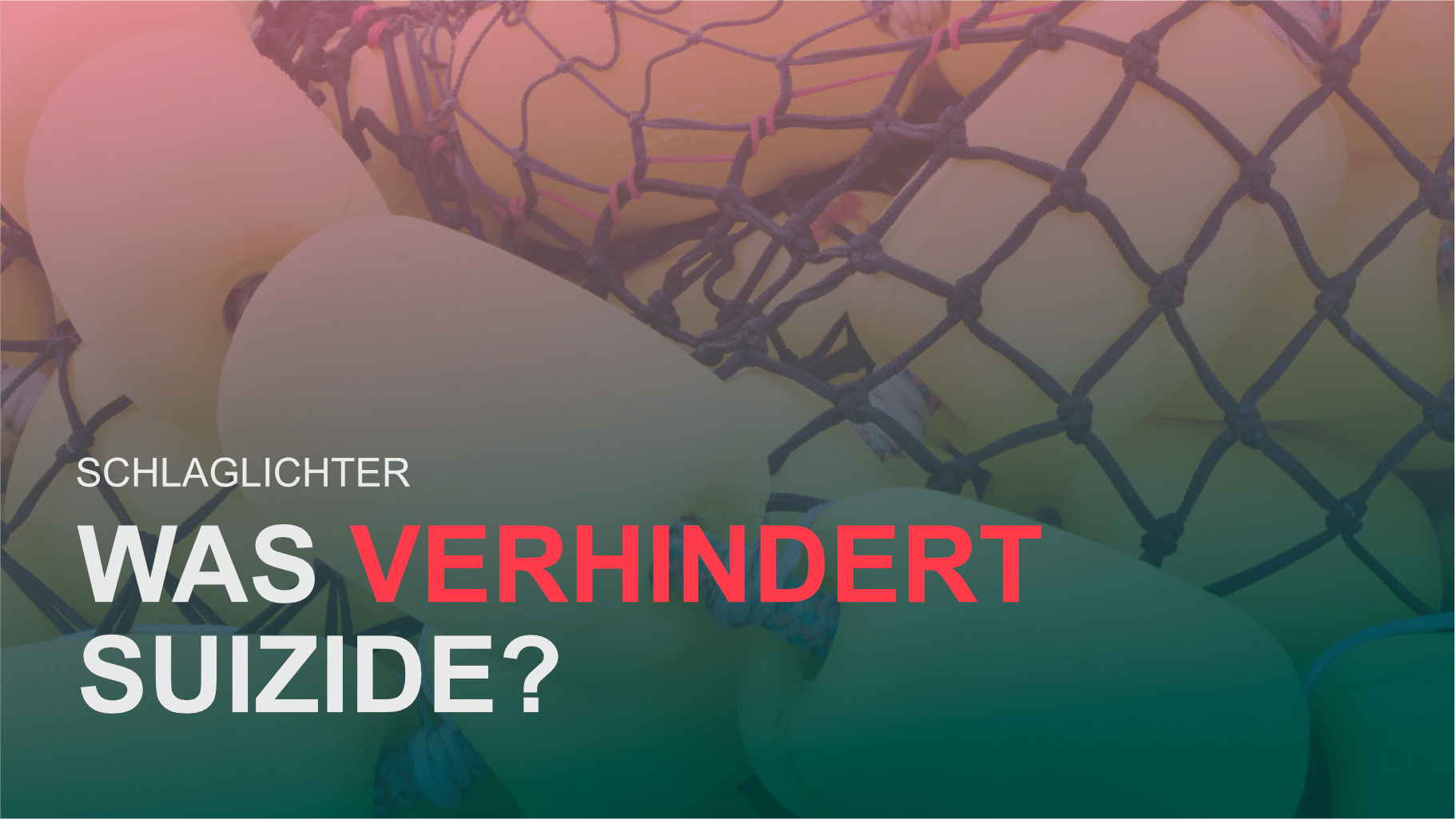
Was verhindert Suizide?
Suizide sind grundsätzlich vermeidbar, schreiben die Autor*innen einer Autopsiestudie. Sie haben die Umstände von Suiziden untersucht und dafür Daten von 626 Suiziden ausgewertet, die zwischen 2001 und 2009 bei der Kriminalpolizei im Allgäu aktenkundig geworden sind.
Während bei nur sieben Prozent der Suizident*innen keine Risikofaktoren vorlagen,
- gab es in mehr als drei Viertel der Fälle negative Lebensereignisse vor dem Suizid,
- hat etwa die Hälfte unter schweren körperlichen Krankheiten gelitten,
- ist ein Drittel wegen einer psychischen Erkrankung in Behandlung gewesen,
- hat fast die Hälfte den Suizid angekündigt oder zumindest angedeutet.
Wenn ein Mensch Risikofaktoren ausgesetzt war und den Suizid angedeutet hatte, hätte präventiv eingegriffen werden können, schlussfolgern die Forschenden. Solche Interventionen müssten bei Hausärzt*innen und Angehörigen ansetzen. Damit letztere die Suizidalität erkennen und Hilfe holen können, brauche es niedrigschwellige Angebote.
Wie geht das, niedrigschwellig intervenieren?
Unsere Hürden, in eine Beratungsstelle zu gehen oder uns jemandem anzuvertrauen, sind unterschiedlich hoch. Niedrigschwellige Angebote haben deshalb so wenige Hürden wie möglich. Sie sind beispielsweise vertraulich und leicht zu erreichen, berücksichtigen kulturelle und religiöse Kontexte und erfordern wenig Papierkram.
Praktisch kann das bedeuten, dass Hausärzt*innen vertrauenswürdige und unterstützende Ansprechpartner*innen sind. Für andere Menschen ist es vielleicht einfacher, sich anonym an eine Hotline zu wenden, die rund um die Uhr erreichbar sein sollte.
Eine Forschungsgruppe der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt fasst es so zusammen: Niedrigschwellige Suizidprävention brauche ein vielfältiges Netzwerk aus Berufsgruppen wie Medizin, Pflege, Psychologie oder Sozialer Arbeit, bestehe aus Angeboten wie Krisendiensten oder Kliniken und müsse in verschiedenen Formaten stattfinden. Auch für Angehörige müsse Unterstützung leicht erreichbar sein.
Aus dem Archiv: Hürden entstehen auch durch Tabuisierung und Stigma. Lasst uns darüber reden, warum wir unsere Einstellung zu psychischer Erkrankung überdenken müssen.
Was sind denn nun die nachweislich besten Methoden gegen Suizide?
Dieser Frage hat sich ein internationales Forscher*innenteam in einem umfangreichen Review gewidmet. Die Wissenschaftler*innen haben die Daten von mehr als 1.700 Studien aus zehn Jahren ausgewertet.
Dabei haben sie drei Methoden gefunden:
- Niedrigschwellige Intervention: Hausärzt*innen, die Suizidalität erkennen und darauf reagieren können, helfen, Suizidraten zu senken.
- Psychopharmaka: Leiden Betroffene an einer psychischen Erkrankung, kann eine medikamentöse Behandlung das Suizidrisiko deutlich senken.
- Weniger Möglichkeiten, weniger Suizide: Das bedeutet zum Beispiel, den Zugang zu Schusswaffen zu erschweren, Medikamente in kleinen Packungen auszugeben oder an sogenannten “Hotspots”, wie Brücken oder Türmen, Gitter oder Fangnetze anzubringen.
Fangnetze verhindern Suizide? Das finden wir interessant. Darum sprechen wir bald mit Thomas Reisch, der sich als Chefarzt der Klinik für Depression und Angst in Münsingen (Schweiz) mit der Sicherung von Hotspots beschäftigt. Ihr habt auch Fragen dazu? Dann schickt sie uns per E-Mail oder antwortet einfach auf diese!
Die drei wirksamsten Maßnahmen um Suizide zu verhindern – darüber hat Thomas Müller ausführlicher in der ÄrzteZeitung geschrieben. Wenn ihr euch dafür interessiert, aber nicht gleich den ganzen Review lesen wollt, empfehlen wir euch seinen Artikel.
Narrativ hinterfragt

Wie sprechen wir über Suizide?
Eigentlich wollten wir uns schon Ende 2021 mit Suiziden beschäftigen. Dann haben wir die Ausgabe verschoben: Zu hart, das Thema, mitten im Winter, im Weihnachtsstress und in der Pandemie. Wir waren unsicher, ob und wie wir es gut ansprechen können.
Unsere eigene Diskussion hat uns (und euch) eine neues Themenfeld in diesem Newsletter beschert: Wir hinterfragen Narrative. Angefangen damit, wie wir als Medien und Gesellschaft die richtigen Worte für Suizide finden.
Macht darüber reden alles schlimmer?
Weil wir selbst Bedenken hatten, in schwierigen Zeiten über schwierige Themen zu schreiben, haben wir Bücher und Paper gewälzt. Dabei sind wir auf einen Satz eines früheren Geschäftsführers der Kanadischen Gesellschaft für Suizidprävention gestoßen:
“Suizidprävention beruht zu einem großen Teil auf unserer Fähigkeit, über Suizid zu sprechen.”
Wir sollten also darüber reden. Die Frage ist nur, wie.
Berichterstattung kann negative Effekte haben
Die wohl bekannteste Folge von Berichten ist der Werther-Effekt. In Anlehnung an Goethes "Die Leiden des jungen Werthers" bezeichnet er, dass die mediale Darstellung von Suiziden zu Nachahmung führen kann. Tatsächlich ist der Zusammenhang wissenschaftlich belegt – vor allem dann, wenn es sich bei den Verstorbenen um berühmte Personen handelt. Das war beispielsweise nach dem Suizid des Fußballspielers Robert Enke 2009 zu beobachten.
Berichterstattung kann die Lage außerdem verschlimmern, indem sie Menschen emotional verstört oder (re-)traumatisiert. Und schließlich festigen falsche Informationen Mythen und Stigmata rund um psychische Erkrankungen und Suizidalität in unseren Köpfen.
Allerdings ist es nicht nur für Journalist*innen wichtig, zu wissen, welche Wirkung Beiträge zum Thema Suizid entfalten können. Auf Twitter oder Instagram werden wir alle in wenigen Sekunden selbst zum reichweitenstarken Medium. Deswegen sollten sich nicht nur Medienschaffende damit auseinandersetzen, wie wir besser über Suizide sprechen.
Wie geht denn nun gute Berichterstattung?
Die Grundlage für gute Berichterstattung über Suizide steht im Pressekodex: Zurückhaltung, vor allem hinsichtlich Namen, Bildern, Methoden und weiteren Details.
Der Medienguide der Stiftung Deutsche Depressionshilfe empfiehlt zudem, Suizide nicht als mystisch, romantisch oder heroisch zu beschreiben. Ebensowenig sollten Suizide als nachvollziehbar oder gar als “einziger Ausweg” dargestellt werden.
Es gibt außerdem Hinweise auf den sogenannten Papageno-Effekt. Er bezeichnet, dass Medien, Berichte und Geschichten eine schützende Wirkung haben können. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn sie Copingprozesse anregen, Hoffnung schenken, Wissen über Suizide und ihre Determinanten vermitteln oder Informationen zu Hilfsangeboten geben.
Also: Gute Berichterstattung über Suizide
- stellt diese als vermeidbare Verluste mit komplexen Ursachen dar,
- weiß, wer ihr Publikum ist und achtet dessen Bedürfnisse,
- berücksichtigt einen möglichen Werther-Effekt und versucht, ihn zu vermeiden,
- klärt über Mythen auf, bietet Informationen, Wege zu Hilfsangeboten und Austausch.
>>> Martin Gommel ist Reporter für psychische Gesundheit bei den Krautreportern und hat selbst chronische Depressionen. Er sagt nicht nur ”wir müssen drüber reden”, sondern tut das auch. Darum haben wir uns mit ihm zum Interview verabredet. Was wir erfahren, lest ihr in unserer nächsten Ausgabe.
Interview
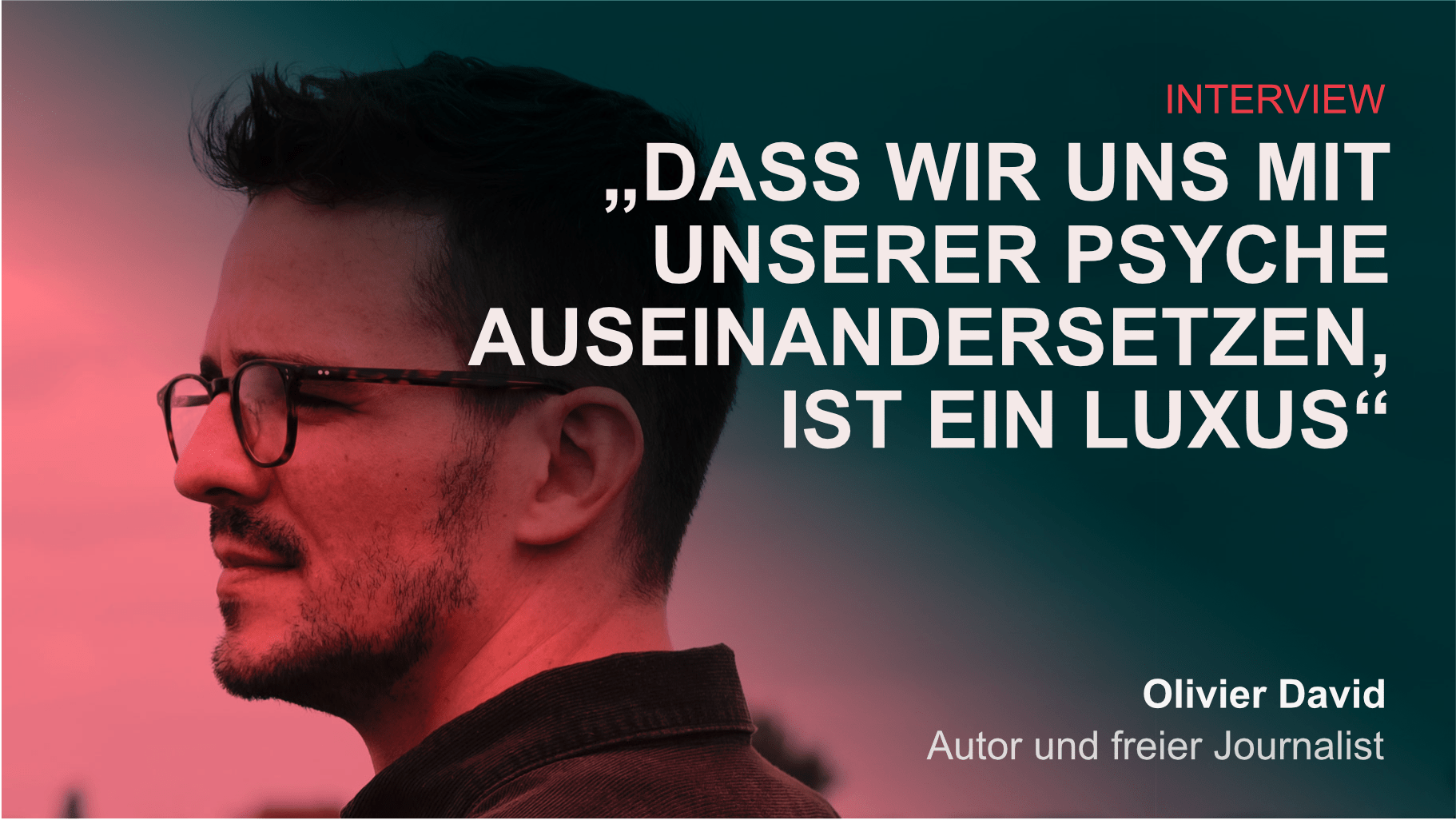
“Dass wir uns mit unserer Psyche auseinandersetzen, ist ein Luxus”
Olivier David ist in relativer Armut aufgewachsen – ebenso wie rund 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland. Bei ihnen wird doppelt so oft ADHS diagnostiziert wie bei Gleichaltrigen aus besser gestellten Verhältnissen. David ist ein Gesicht hinter diesen Zahlen. Er hat die Diagnose rückwirkend bekommen. Erst als Erwachsener hatte er ausreichend Sicherheit, sich mit seiner Psyche zu beschäftigen.
Wie würdest du anhand deiner Erfahrung den Zusammenhang von Armut und psychischer Krankheit beschreiben?
Armut bedeutet oftmals einem höheren Stresslevel ausgeliefert zu sein. Das Leben ist zwar für jede*n anstrengend, unabhängig von ökonomischen Fragen, aber wenn du noch zusätzlich Fragestellungen hast, die nur arme Menschen betreffen, ist das besonders erschöpfend.
Was sind das für Fragestellungen?
Das kann die Frage sein: Kann ich einen Antrag auf Wohngeld schreiben? Oder: Die Miete wird erhöht, wie soll ich das bezahlen? In Deutschland hat jeder dritte Mensch keine Rücklagen gebildet. Als die Waschmaschine meiner Familie kaputt ging, fehlte uns das Geld, um eine neue zu kaufen. Meine Mutter musste einen Antrag schreiben, damit das Amt uns eine bezahlt. Da ist es aber häufig mit einem Brief nicht getan und du lebst bis zum Bescheid in ständiger Unsicherheit. Gleichzeitig gibst du in jede Woche zehn Euro aus, um die Wäsche zu waschen, so dass du kein Geld sparen kannst, um dir selbst eine neue Waschmaschine zu kaufen.
Wie wirken Armut und psychische Gesundheit zusammen?
Wenn du mit einer Mutter aufwächst, die alleinerziehend ist, erhöht das dein Risiko für eine psychische Erkrankung. Wenn du mit einer Mutter aufwächst, die alleinerziehend ist und Schulden hat, erhöht sich dein Risiko zusätzlich. Wenn du mit einer Mutter aufwächst, die alleinerziehend ist, Schulden hat, eine psychische Erkrankung hat, selber in Armut geboren ist, der zu wenig Handwerkszeug zur Verfügung steht und wenn du dann noch kaum Selbstwirksamkeit erfährst in deinem Aufwachsen, dann reden wir in meinem Lebenslauf von erlernter Hilflosigkeit. Ich habe nicht nur kein Handwerkszeug bekommen, um mir selbst zu helfen. Ganz im Gegenteil. Ich habe destruktives Handwerkszeug bekommen, das verhindert, dass ich mich selbst um mein Schicksal kümmere.
Was hat bei dir schließlich den Ausschlag gegeben, dir Hilfe zu suchen?
Bei mir war das derselbe Mechanismus wie bei meiner Mutter. Als sie einen Job gefunden hatte, konnte sie sich wenig später eine Therapie suchen. Ich habe mich durch mein Volontariat und eine neue Beziehung so gesichert gefühlt, dass ich das erste Mal den Raum gespürt habe, Innenschau zu betreiben. Dass wir uns heute mit unserer Psyche auseinandersetzen, meine Familie und ich, ist ein Luxus, den wir uns von unserem Alltag abringen. Das ist eigentlich total paradox. Erst muss es dir besser gehen, damit du dir erlauben kannst, dass es dir schlechter geht.
Was muss sich verändern, dass es jungen Menschen in einer ähnlichen Situation sind, wie du vor 15 Jahren, besser geht?
Zunächst braucht es natürlich Akuthilfe. Hilfsangebote können nicht niedrigschwellig genug sein. Die Frage darf nicht sein, ob ein Angebot grundsätzlich da ist. War ein Jugendzentrum bei mir um die Ecke? Ja. Gab es da Hausaufgabenhilfe? Ja. Die Frage ist, wie erfahre ich davon? Wie gering ist meine Selbstwirksamkeitserfahrung oder die von meiner Mutter, dass wir das Angebot wahrnehmen und in Anspruch nehmen? Ein niedrigschwelliges Angebot sieht so aus, dass Leute von Tür zu Tür ziehen und fragen: “Kommst du mit deinem Alltag klar? Wir helfen dir. Kommt dein Sohn mit seinen Hausaufgaben klar? Wir helfen dir. Wir haben keine Agenda, sind von keiner Partei oder Kirche, wir sind einfach für dich da. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, wir kommen. Alles wird gut.”
Welche Rolle spielt die Politik dabei?
Armut ist politisch gewollt. Es gibt kein Interesse, Armut zu überwinden. Unser Wirtschaftssystem muss Ausschlüsse produzieren, um den Wohlstand einiger weniger zu sichern. Wir müssen uns der Frage stellen, wie wir eine gerechte Gesellschaft bauen können. Das geht nur für sukzessive, Stück für Stück. Aber wir täten gut daran, das Gespräch lauter werden zu lassen darüber, welche Kosten Armut produziert, auf persönlicher, wie auf gesellschaftlicher Ebene.
>>> Wir haben länger mit Olivier David gesprochen: Welchen Sound hat Armut und wie wird der zum Backgroundtrack im Lebenslauf? Wie kann man die Spirale erlernter Hilflosigkeit durchbrechen? Und was haben Medien, Politik und geklaute Fahrräder damit zu tun? Das lest ihr auf unserer Website.
Aktuelles
Was du sonst noch wissen musst
- Spätestens seit der Covid19-Pandemie ist Vulnerabilität ein geflügeltes Wort. ”Doch die Verwundbarkeitsdiskurse der Politik verschleiern Ungleichheiten und Machtverhältnisse“, schreibt die Philosophin Jule Govrin für das Magazin Geschichte der Gegenwart.
- Antriebslosigkeit durch Baklava? Nein, Hashimoto. Was es bedeuten kann aufgrund von Stereotypen bei der Ärztin nicht ernstgenommen zu werden, bespricht Aya Jaff im Podcast Heimatmysterium (Spotify).
- Coronaleugner*innen und Impfgegner*innen haben oft ein großes Sendungsbewusstsein. Was aber passiert, wenn sie auch Ärzt*innen sind? Meistens lange nichts. Warum, berichten Jörg Hilbert und Leon Enrique Montero.
Anhang
Ausblick
Eine traurige Neuigkeit zuerst: Vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Anne hat unser Team leider verlassen, denn sie ist voll in ihr Medizinstudium eingespannt. Vorerst schreiben wir euch also nur noch zu zweit. Aber sind das jetzt die versprochenen Neuerungen bei Upstream?
Nein, die liegen noch in der Zukunft. Aber ein wenig schimmern sie diese Ausgabe schon durch. Unser Plan: Upstream wird eine Community für faire Gesundheit. Das bedeutet, wir wollen nicht nur tiefer recherchieren, sondern auch euch noch mehr in unsere Recherchen einbinden. Denn so wird unser Journalismus besser. Dafür werden wir uns in Zukunft stärker mit euch austauschen und euch miteinander ins Gespräch bringen.
Wir fragen uns, wie Upstream euch den größten Nutzen bringt. Habt ihr Lust auf Diskussionen, Workshops, Twitter-Spaces? Die ersten haben wir dazu schon angeschrieben. Wenn wir dich noch nicht angeschrieben haben und du dich einbringen magst, schreib uns einfach.
Upstream soll in Zukunft nicht mehr “nur” der lange Newsletter sein, der einmal im Monat in eurem Postfach landet. Wir wollen uns in alter Ausgeruhtheit und Tiefe auch aktuelleren Themen widmen. Wie das aussehen kann, soll auch Ergebnis unserer Gespräche mit euch werden.
Also bleibt gespannt (und gesund)! Spätestens am 24. März lest ihr wieder von uns.
Transparenz
Rund um medizinische Themen sind Transparenz und Vertrauen wichtig. Darum stellen wir am Ende jeder Ausgabe unsere Quellen vollständig dar. Auf der Website ist unser journalistisches Selbstverständnis festgehalten.