Wo kein Weg ist, schwindet der Wille
Orte, an denen Menschen vermehrt versuchen sich das Leben zu nehmen, nennt man Hotspots. Wir haben recherchiert, wie sich Hotspots wirkungsvoll sichern lassen und wie es nach einem versuchten Suizid für Betroffene weitergehen kann.

Takeaways
Das erwartet dich in dieser Ausgabe
- Konzept erklärt: Hotspot-Sicherung versperrt Wege in den Suizid
- Schlaglichter: Wer ebnet den Rückweg nach einem Suizidversuch?
- Aktuelles: Unter anderem mit einer Außensicht auf Bremens Impfrekord, dem Vorwurf strukturellen Rassismus’ in Uelzen und dem Blick in eine inklusive Redaktion aus Österreich.
Wer fängt dich auf, wenn du es brauchst?
Wo kein Weg ist, schwindet der Wille
Hallo!
Seit vergangenem November beschäftigen wir uns mit Themen rund um psychische Gesundheit, seit Februar explizit mit Suiziden. Diese Ausgabe soll die Reihe abschließen. Im Februar haben wir festgestellt: Suizide sind vermeidbare Todesfälle. Vor drei Wochen haben wir mit Martin Gommel darüber gesprochen, weshalb es wichtig ist, Begriffe für das zu haben, was im eigenen Kopf los ist.
Jetzt geht es um ein ganz konkretes “Wie”: Hotspot-Sicherung bedeutet, Orte, an denen häufig Suizide geschehen, so zu gestalten, dass das nicht mehr möglich ist. Klingt fast zu simpel, um wirkungsvoll zu sein. Oder? Außerdem fragen wir uns, wie der Weg nach einem versuchten Suizid weitergeht.
Danke, dass du uns so treu begleitest! Ab der kommenden Ausgabe stellen wir eine neue Frage: Warum werden unsere Körper ungleich behandelt, je nachdem, wie viel sie wiegen? Wir freuen uns über deine Hinweise und Fragen und natürlich auch, wenn du Upstream deinen Freund*innen und Kolleg*innen empfiehlst. Mehr dazu gibt’s im Ausblick. ⬇
Herzliche Grüße!
Sören und Maren
Achtung: In dieser Ausgabe sprechen wir über Suizide und Suizidmethoden. Wenn dir dieses Thema nicht gut tut, lies den Newsletter lieber nicht oder nicht alleine.
Dir geht es aktuell nicht gut? Hier findest Du Hilfe:
- Wende dich an deine hausärztliche Praxis oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst.
- Kontaktiere die Telefonseelsorge.
- Suche in den Listen der Deutschen Depressionshilfe und der Neurologen und Psychiater im Netz nach spezifischen Hilfsangeboten.
- Rufe bei Notfällen wie drängenden und konkreten Suizidgedanken einen Notarzt über die 112.
Konzept erklärt

Hotspot-Sicherung versperrt Wege in den Suizid
Ein Hotspot ist im Kontext von Suiziden ein Ort, an dem Menschen diese gehäuft begehen. Das können beispielsweise hohe Gebäude, Brücken oder Bahngleise sein. Was genau “gehäuft” bedeutet, ist nicht einheitlich definiert. Der Psychiater Thomas Reisch beziffert Hotspots mit . Suizide durch “Sturz in die Tiefe” oder “bewegende Objekte” waren 2020 in Deutschland die dritt- und vierthäufigsten Methoden.
Hotspots abzusichern kann bedeuten, Brückengeländer so hoch zu bauen, dass niemand hinübersteigen kann, oder horizontale Netze an hohen Gebäuden oder steilen Abgründen anzubringen, über die auch sportlichste Menschen nicht springen können.
Auch an den 33.401 Kilometern Bahnstrecke in Deutschland gibt es zahlreiche Hotspots. Drei Viertel dieser Orte liegen in unmittelbarer Nähe zu psychiatrischen Kliniken. Hier könnten gezielt Zäune, Mauern oder Bewegungsmelder angebracht werden.
Wer es wirklich will, findet doch einen Weg? – Nein!
“Dann springen sie eben woanders” – dieser Satz ist uns in der Recherche häufig begegnet. Ebenso häufig sind wir auf Daten und Experteneinschätzungen gestoßen, die dem widersprechen. Drei Beispiele:
- An den Münsterterrassen in Bern sind 1998 Fangnetze angebracht worden. Zuvor galt der Ort als Hotspot. Mit den Netzen blieben die Suizide aus – obwohl es möglich gewesen wäre, sie zu umgehen. An hohen Brücken in Laufweite von den Terrassen ist die Zahl der Suizide nicht gestiegen.
- Die Duke Ellington Memorial Bridge in Washington D.C. hat seit 1985 ein hohes Geländer. In den sieben Jahren zuvor waren dort 24 Menschen durch Suizid gestorben. In den darauffolgenden fünf Jahren war es eine Person. Nur ein paar hundert Meter weiter befindet sich eine ungesicherte Brücke. Die Zahl der Suizide dort ist nicht angestiegen.
- Der Psychologe Richard Seiden dem Schicksal von 515 Menschen nachgegangen, die zwischen 1937 und 1971 davon abgehalten wurden, von der Golden Gate Bridge in San Francisco zu springen. Seiden fand heraus, dass 25 von ihnen bis 1978 durch Suizid gestorben sind. Die Hypothese, dass Menschen, die nicht von der Golden Gate Bridge springen, einfach woanders hingehen, sah er damit als widerlegt an.
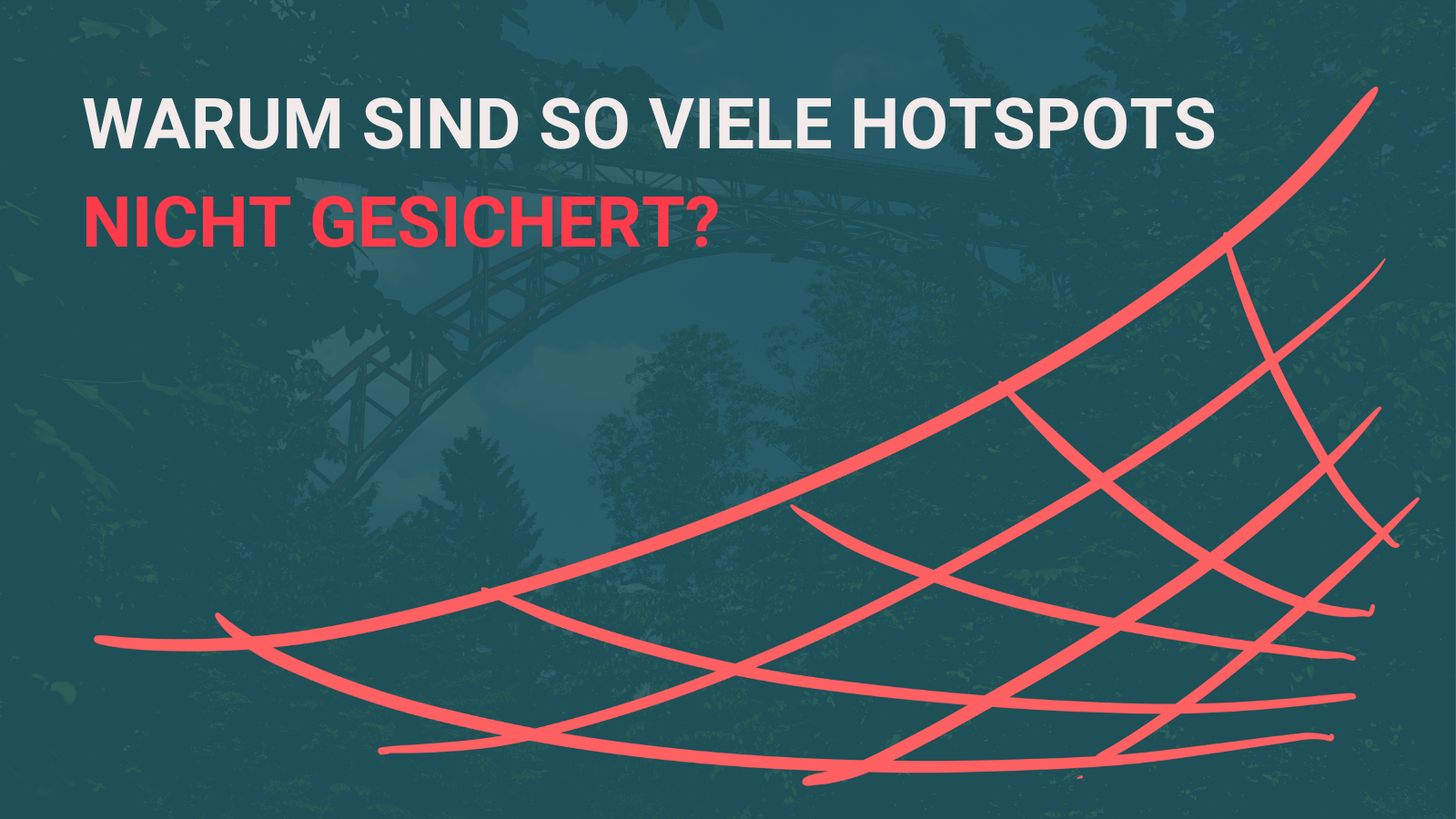
Warum sichern wir nicht einfach alle Hotspots ab?
Die höchste Eisenbahnbrücke in Deutschland ist 107 Meter hoch. Unabhängig davon, welche Definition man ansetzt, ist sie ein Hotspot für Suizide. Neben Zugehörigen leiden infolge der Selbsttötungen auch immer wieder Spaziergänger*innen, die Ausflugsziele unterhalb der Brücke besuchen. Als die Deutsche Bahn 2010 ankündigte, die Brücke zu sanieren, regte das Nationale Suizidpräventionsprogramm an, endlich Maßnahmen umzusetzen, die die Suizide verhindern.
Die Bahn unterstützte die Bemühungen zunächst. Die Kosten für den Bau erschienen hinnehmbar angesichts geschätzter jährlicher finanzieller Kosten von rund 400.000 Euro für Rettungs- und Bergungseinsätze.
Allerdings gibt es ein Problem: Die Brücke steht seit 1985 unter Denkmalschutz. Schön für das beeindruckende Bauwerk, schlecht für die Suizidprävention, denn die Brücke baulich zu verändern wird abgelehnt.
In Deutschland gibt es bislang keine Regelungen, die festlegen, ob und wie Baumaßnahmen an Brücken umgesetzt werden sollen, die Suizide verhindern können. Auch ein Förderprogramm für solche Maßnahmen fehlt. Dabei müssen es nicht immer Fangnetze sein:
Das Nationale Suizidpräventionsprogramm hat 2014 herausgegeben. Dazu zählen neben den Netzen: Erhöhte Geländer, Kunststoffwände, Überwachungskameras, Schilder mit Informationen über telefonische Hilfsangebote, Patrouillen, Medienguidelines und das Stärken von Zivilcourage. Die Verkehrsminister*innen von Bund und Ländern könnten hier klare Regeln und Möglichkeiten schaffen.
Schlaglichter

“Ein glückliches Leben nach Suizidalität ist nicht nur möglich – es ist wahrscheinlich”
Wie geht es Menschen, wenn sie die Gedanken, ihren Tod herbeizuführen, hinter sich lassen? Viele Studien legen den Fokus darauf, wie schlecht es Betroffenen geht und ob sie psychisch erkrankt sind. Das ist natürlich berechtigt. Wie gut es ehemals suizidalen Personen geht, ist allerdings selten die Frage. In den Antworten könnten aber wichtige Ressourcen und Hoffnung für die Betroffenen stecken.
Nachdem die Suizidrate in den USA zwischen 1999 und 2014 um fast ein Drittel angestiegen ist, untersuchte ein Forscher*innenteam um Craig Bryan genau diese Frage. Da Mitglieder des Militärs besonders betroffen waren, befragten Bryan und seine Kolleg*innen rund 1.000 Militär-Angehörige. Jede*r Fünfte berichtete, suizidale Gedanken erlebt zu haben, vierzig Personen hatten einen Suizidversuch überlebt.
Und wie gut ging es ihnen?
Der Blick in die Daten zeigt: nicht ganz so gut wie denjenigen, die zuvor nicht suizidal waren. Allerdings erlebten zwei von drei Befragten, die schon mal Suizidgedanken hatten, durchschnittlich bis überdurchschnittlich viel Freude im Leben. Unter denjenigen, die einen Suizid versucht hatten, war es jede*r Zweite. Und: Im ersten Jahr nach Suizidgedanken oder -versuch erreichte die Mehrheit der Befragten das gleiche Level von Freude und Sinn im Leben wie Personen, die nie suizidal waren.
Die Forschenden schließen: Freude und Sinn zu empfinden, nachdem man suizidal war, ist nicht nur möglich, sondern auch wahrscheinlich. Ein Befund, der Hoffnung macht.
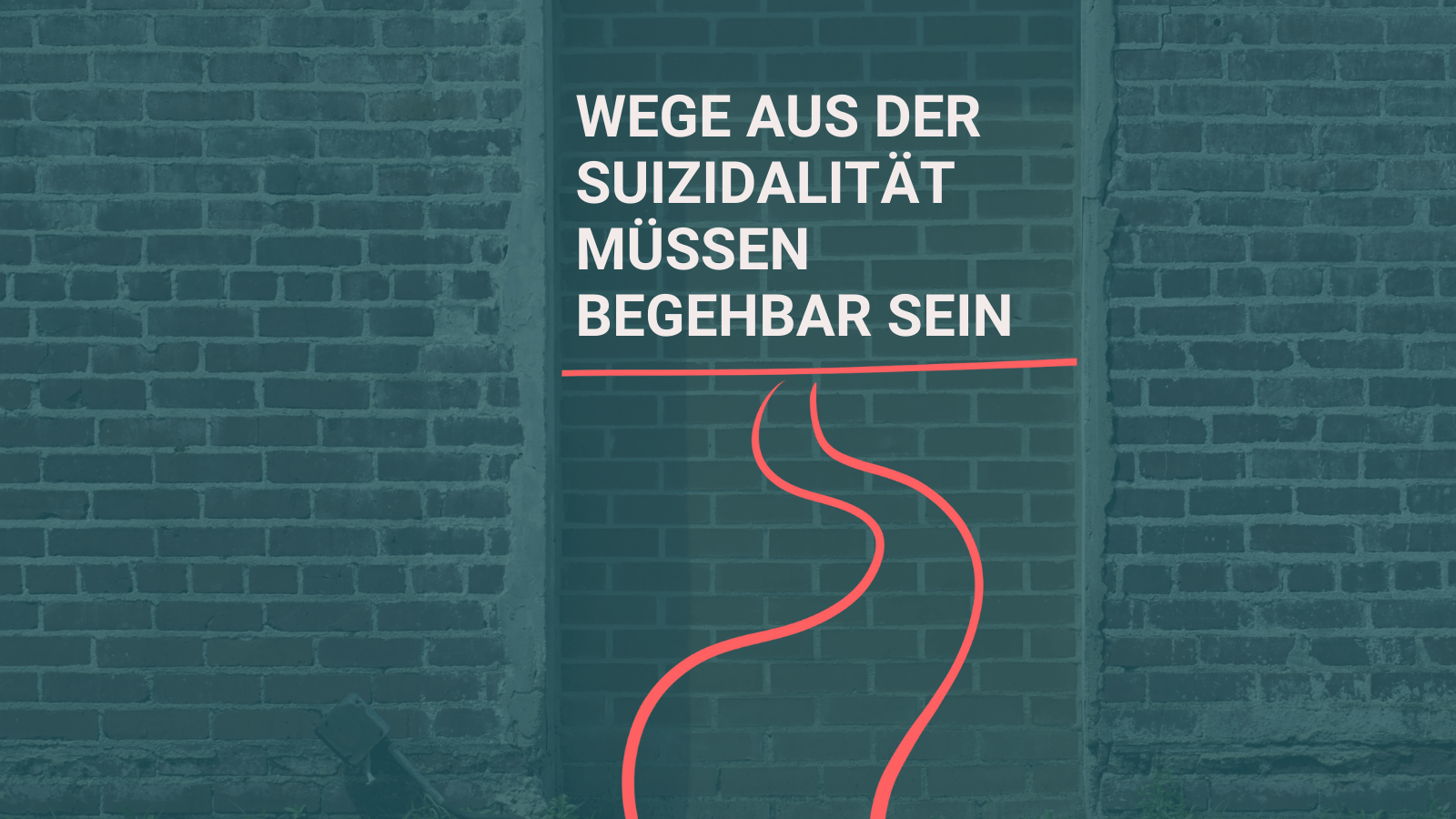
Der Wendepunkt von unmöglichen auf mögliche Wege
Trans Personen, also Menschen, denen bei der Geburt ein Geschlecht zugewiesen wurde, das nicht ihrer Identität entspricht, haben ein besonders hohes Risiko für Suizidalität. Bei einer Befragung von fast 28.000 trans Personen in den USA im Jahr 2015 gaben 40 Prozent an, dass sie einen Suizidversuch überlebt haben. Diese Rate ist neunmal so hoch wie die Suizidrate der Gesamtbevölkerung. Häufig treffen bei trans Personen individuelle Risikofaktoren wie Angst, Depression oder Selbststigmatisierung auf strukturelle Risiken wie Diskriminierung und Gewalt.
Es gibt Daten, die darauf hindeuten, dass Suizidgedanken bei trans Personen mit dem Alter abnehmen, weil sie Resilienz entwickeln. Ein Forscher*innenteam um Eleni Gaveras hat sich deshalb Interviews mit 14 älteren trans Personen genauer angesehen, deren Antwort auf eine Frage sehr ähnlich war:
“Wie identifizierst du dich heute und was waren Meilensteine auf dem Weg zu deiner Identität?”
Alle haben von sich aus davon berichtet, wie sie Suizidgedanken oder -versuche überlebt haben. Und alle hatten ein ähnliches Narrativ: von einem unmöglichen Weg, auf dem sie das Gefühl hatten, hoffnungslos auf der Stelle zu stehen, hin zu möglichen Wegen, die zu einem bewussten Leben und Selbstverwirklichung führten. Die Wendung brachte der klare Entschluss, den geplanten Suizid abzubrechen und nach Unterstützung zu suchen.
Gaveras und ihr Team betonen, dass in jeder Geschichte Unterstützung eine wichtige Rolle spielte. Das war zum einen soziale Unterstützung, durch Familie, Partner*innen, Freund*innen und das Umfeld. Zum anderen war neben psychologischer Unterstützung besonders wichtig, dass die Menschen die Möglichkeit hatten, ihre Identität kennenzulernen und Zugang zu Gesundheitsversorgung und geschlechtsangleichenden Behandlungen zu bekommen.
Diesen Zugang haben nicht alle. In Deutschland sorgt veraltete Gesetzgebung dafür, dass trans Personen sich langen und oft belastenden Verfahren unterziehen müssen. Das Selbstbestimmungsgesetz lässt auf sich warten. In mehreren US-Bundesstaaten gibt es Gesetzentwürfe, die klar transfeindlich sind.
>>> Die Interviews der Analyse sind aus dem Fotoprojekt To Survive on this Shore. Was denkst du: Wie können Gesellschaft und Gesundheitssystem trans Personen besser schützen? Kennst du Studien, Projekte oder Initiativen? Schreib uns eine Mail oder zwitscher uns auf Twitter an.
Aktuelles
Was du sonst noch wissen musst
- Bremen hat in Deutschland bei fast allem die schlechtesten Zahlen – abgesehen von der Impfquote, die bundesweit die höchste ist. Damit hat die Stadt es jetzt auch in die New York Times geschafft. Bülent Aksakal, mit dem wir in Ausgabe 2 gesprochen haben, berichtet in dem Artikel, wie er Menschen im Stadtteil Gröpelingen überzeugt und begleitet hat.
- “Starb Valérie, weil eine Ärztin sie nicht ernst nahm?” Eine Kinderärztin soll die schlimmen Beschwerden des siebenjährigen Schwarzen Mädchens nicht ernstgenommen haben. Valérie ist kurz nach der Untersuchung an einem Blinddarmdurchbruch gestorben. Aktivist*innen sehen strukturellen Rassismus im Gesundheitswesen als Ursache. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.
- Die Impfung gegen das Corona-Virus rettet Leben. Millionen von Menschen haben sie ohne Probleme oder nur mit kurzfristigen Nebenwirkungen vertragen. Aber es gibt sie eben doch, die Impfnebenwirkungen. Die Betroffenen fühlen sich allein gelassen, zeigt dieses Video von MDR Umschau.
- “Hier wird nicht danach gefragt, ob jemand finanziell bedürftig ist. Es gibt ja auch Bedürftigkeit in anderer Hinsicht.” Das sagt Jörg vom Verein Helfende Hände im brandenburgischen Storkow. Katja Döhne und Anne Thiele haben den Sozialverein für das Y-Kollektiv besucht.
- “Einsam sein ist so gefährlich wie 15 Zigaretten am Tag” – was an dieser These dran ist und wo genau eigentlich der Unterschied zwischen einsam und allein sein ist, erfährst du im Video von Psychologeek.
- Viele journalistische Redaktionen beschäftigt die Frage: Wer schreibt eigentlich über wen? Auch wir bei Upstream müssen regelmäßig unsere Perspektiven hinterfragen und überlegen, wie wir möglichst vielen Stimmen Gehör verschaffen können. Andererseits ist eine inklusive Redaktion aus Österreich, in der Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam recherchieren, schreiben und zusammenarbeiten. In einer Crowdfundingkampagne wirbt die Redaktion für eine nachhaltige Finanzierung. Wir finden das unterstützenswert!
Ausblick
Wir haben einen Blick auf unseren Kalender geworfen. Dabei haben wir zweimal einen kleinen Schreck gekriegt. Einmal, weil es Upstream jetzt schon fast seit einem Jahr gibt. Yeah!
Den zweiten Schreck haben wir bekommen, als wir festgestellt haben, dass in jede Upstream-Ausgabe etwa eine Woche Arbeitszeit fließt. Das ist cool, denn so können wir sorgfältig recherchieren, Themen bedacht auswählen und Interviews in Ruhe führen. Weil wir als studentisches Projekt gestartet sind, konnten wir uns diese Zeit immer nehmen.
Langsam aber sicher müssen wir Upstream als Teil unseres Berufes als Journalist*innen gestalten. Das wird ein spannender Prozess – und hoffentlich ein guter, denn wir wollen diesen Newsletter fortführen. Den ersten Schritt machen wir aktuell schon: Wir fokussieren uns in Reihen noch stärker auf ein Thema.
Im nächsten Schritt werden wir Upstream von Revue auf die Plattform Steady umziehen. Für dich ändert sich erstmal nicht viel. Du erhältst weiterhin regelmäßig einen Newsletter von uns. Upstream bleibt kostenlos, unabhängig und werbefrei. Neu wird sein, dass du uns unterstützen kannst. Über Steady kannst du uns monatlich einen kleinen Geldbetrag schicken, mit dem wir den Newsletter finanzieren können. Wir können damit unsere eigene Arbeit ebenso honorieren wie Gastbeiträge von anderen Autor*innen. Eine Paywall wird es aber nicht geben, versprochen!
In der kommenden Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Ungleichheit von Übergewicht. Was ist das überhaupt, Übergewicht? Wie ungleich sind Kilos, Stigma und Belastung verteilt? Upstream-Leser Benedikt hat gerade sein Medizinstudium abgeschlossen und uns auf die Folge Adipositas, Antibiotika, Abschied des Podcasts Studienlage aufmerksam gemacht, die wir an dieser Stelle schon mal weiterempfehlen wollen.
Hast du Erfahrungen oder Wissen zu Übergewicht? Schick uns gerne Studien, Empfehlungen und eigene Geschichten. Dafür kannst du einfach auf diese Mail antworten.
Wir freuen uns auf die Zukunft von Upstream. Schön, dass du dabei bist!
Anhang
Transparenz
Rund um medizinische Themen sind Transparenz und Vertrauen wichtig. Darum stellen wir am Ende jeder Ausgabe unsere Quellen vollständig dar. Auf der Website ist unser journalistisches Selbstverständnis festgehalten.
In Ausgabe 10 haben wir angekündigt, dass wir mit dem Chefarzt der Klinik für Depression und Angst in Münsingen (Schweiz), Thomas Reisch, über Hotspot-Sicherung sprechen wollen. Das Interview ist nicht zustande gekommen. Anfang des Jahres ist bekannt geworden, dass das Psychiatriezentrum Münsingen Anhängerinnen der “Kirschblütengemeinschaft” beschäftigt hat. Die Gemeinschaft ist sektenähnlich und setzt auf zweifelhafte Therapiemethoden. Während der Fall untersucht wird, hat Thomas Reisch sich nach Angaben der Klinik vorerst von seinen Funktionen zurückgezogen.
Quellen
- Blaustein, M., Fleming, A. (2009): Suicide From the Golden Gate Bridge. In: American Journal of Psychiatry 200ß; 166:10:1111-1116. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2009.09020296
- Bryan, C. J., Bryan, A. O., Kopacz, M. S. (2019): Finding purpose and happiness after recovery from suicide ideation. In: The Journal of Positive Psychology. https://doi.org/10.1080/17439760.2019.1676460
- Curtin, S. C., Warner, M., Hedegaard, H. (2016): Increase in suicide in the United States, 1999-2014. NCHS data brief, no 241. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db241.htm (abgerufen am 6.4.2022)
- Gaveras, E. M., Fabbre, V. D., Gillani, B., Sloan, S. (2021): Understanding past experiences of suicidal ideation and behavior in the life narratives of transgender older adults. Qualitative Social Work. October 2021. doi:10.1177/14733250211051783
- James, S. E., Herman, J. L., Rankin, S., Keisling, M., Mottet, L., Anafi, M. (2016). The Report of the 2015 U.S. Transgender Survey. Washington, DC: National Center for Transgender Equality.
- Mend, K., Reisch, T., Marten, P., Brockmann, E., Käufer, M., Gravert, C., Schmidtke, A. (2015): Suizidprävention an einer Brücke: Beispiel Müngstener Brücke. https://www.hinas.de/images/veranstaltungen/UeberdieWupper/mend_15-07-24.pdf (abgerufen am 5.4.2022)
- Müller, S., Giegling, I., Hegerl, U, Bennefeld-Kersten, K., Meischner-Al-Mousawi, M., Glasow, N., Reisch, T., Rademacher, K., Mend, H. K., Schmidtke, A., Rujescu, D. (2021): sghskj In: Schneider, B., Lindner, R., Giegling, I., Müller, S., Müller-Pein, H., Rujescu, D., Urban, B., Fiedler, G. (2021): Suizidprävention Deutschland. Aktueller Stand und Perspektiven. Kassel. Deutsche Akademie für Suizidprävention (DASP). S. 41-60.
- Nuttbrock, L., Hwahng, S., Bockting, W., Rosenblum, A., Mason, M., Macri, M., Becker, J. (2010): Psychiatric impact of gender-related abuse across the life course of male-to-female transgender persons. J Sex Res. 2010 Jan;47(1):12-23. doi: 10.1080/00224490903062258.
- O’Carroll, P.W., Silverman, M.M. (1994): Community suicide prevention: the effectiveness of bridge barriers. In: Suicide Life Threat Behav 1994; 24:89–91.
- Reisch, T., Michel, K. (2005): Securing a suicide hot spot: effects of a safety net at the Bern Muenster Terrace. In: Suicide Life Threat Behav 2005; 35:460–467. doi: 10.1521/suli.2005.35.4.460
- Seiden, R.H. (1978): Where are they now? a follow-up study of suicide attempters from the Golden Gate Bridge. Suicide Life Threat Behav 1978; 8:203–216